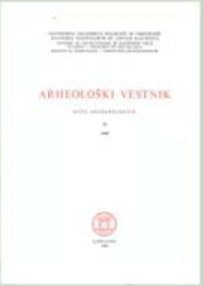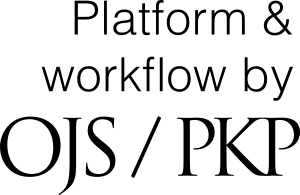Zagorje v prazgodovini
Povzetek
Das Material vom aneolithischen und Urnenfelder Horizont entstammt der ersten Fundstelle (Nr. 1), wo es in den J ahren 1882 und 1886 ausgegraben worden ist. Im urnenfelderzeitlichen Teil der Funde ist ohne Schwierigkeiten ein Depotfund zu erkennen (Taf. 2, 7 bis 4, 2 und Abb. 1). Er zeigt alle Merkmale ostalpiner Depots des Typus Grossmungl (Ha A) nach Mi.iller-Karpe16 oder Ha A 2 Depotfunde nach VinskiY Der aneolithische Tei! der Funde (Taf. 1-2, 6) ist kulturell und zeitlich in Verbindung mit dem Laibacher Moor zu bringen. Fi.ir jedes Sti.ick konnen wir Gegensti.icke vom Laibacher Moor19 anfi.ihren. Besonders zu erwahnen ist das Kupferbeil (Taf. 2, 6), Typus III-3, nach Garašanin (Anm. 10-15). Die Fundberichte bringen unser Material in Zusammenhang mit Skeletten. Da der urnenfelder[1]zeitliche Tei! des Materiales bestimmt zum Depot gehort, ware mu an aneolithische Graber zu denken, doch gibt auch dafi.ir die Struktur des Materials keinen sicheren An hal tspunkt. Die Hallstatter Graber von Zagorje gehoren zur Siedlun.g auf der Anhohe Ocepkov hrib und wurden im Bereich des damaligen Milačhauses gefunden. Eine Analyse der Fundberichte und der alten lnventarbi.icher ermoglicht 1ms die Schei. dung des Materials nach den Ausgrabungsjahren, wie wir das auch in den Tafeln durchgefi.ihrt haben. Das gesamte MateriaL wie es ins Nationalmuseum gebracht worden ist, gehort zu etwa 12 Grabern, tatsachlich jedoch wurden viel mehr Gra[1]ber entdeckt. Besonders bedeutsam ist das im J ahr 1896 ausgegrabene Material, das u. a. ein figura! ornamentiertes Gi.irtelblech (Taf. 7, 3) enthalt. Wie aus dem Inventarbuch hervorgeht, gehort das gesamte in jenem J ahr ausgegrabene Material (Taf. 5, 8--8, 5) zu einem weiblichen und einem (moglicherweise zwei) mannlichen Skeletten. Dem Frauenskelett liesse sich der Spinnwirtel zusprechen (Taf. 5, 12), wahrscheinlich die Certosafibel (Taf. 5\ 1121), das Reiflein (Taf. 6, 4), vielleicht auch die beiden Halsringe (Taf. 6, 5, 6). Aus dem i.ibrigen Material ergibt s ich fast zwanglos der Bestandteil eines reichen Mannergrabes. Mit Sicherheit di.irfen wir annehmen, dass der Trager des figuralornamentierten Gi.irtelbleches auch die Situla (Taf. 6, 1-3) und die i.ibliche Ausri.istung eines Kriegers mit ins Grab bekommen hatte: das skythische Pferdegeschirr (Taf. 6, 1-3), zwei Lanzen (Taf. 8, 3'-4) und das eiserne Beit' (Taf. 8, 1), sarnt zwei Reifchen, die zum Gi.irtelbeschlag gehoren (Taf. 5, 8-9). Es ware gut denkbar, dass dem Besitzer des figura! ornarnentierten Gi.irtelbleches auch beide Figuralfibeln (Taf. 7, 1-2) gehorten. Es ist begreiflich, dafl ein solcher Vornehrner sogar zwei Gi.irtelbleche (noch Taf. 8, ?) und zwei Streitbeile (noch Taf. 8, 2) ins Grab bekarn, und neben der Bronzesitula noch ein Gefass (Taf. 5·, 13-; heute ist nur noch sein Fuss erhalten, Mi.illner erwahnt im Inventarbuch ausdriicklich Bruchsti.icke eines Este III Gefasses). Ebenso gehorte zum Prunkbegrabnis die Mitbestattung eines Pferdes ~ unter Inv. Nr. P 4396 erwahnt Miillner Beinknochen eines Pferdes - und auch die Rinderknochen sind nicht ungewohnlich (Inv. Nr. P 4356 spricht von Oberschenkelbeinen eines Rindes). Bei den beiden Halsringen Hisst sich schwer entscheiden, ob sie der Ausstattung eines Manner- oder eines Frauengrabes zuzusprechen sind, denn fi.ir beide Moglich[1]keiten gibt es Analogien.22 Wo ein Bronzehalsring in einem Mannergrab auftritt, vergesellschaftet mit einern Streitbeil, pflegen auch je zwei gleiche Fibeln vorzu[1]kornrnen,23 was abermals eine Analogie bote zu unserem Paar figuraler Fibeln. Den Versuch der Rekonstruktion des Skelettgrabes mit figuralornarnentiertern Giirtelblech habe ich mit Absicht eingehender ausgefiihrt, urn den Wabrscheinlich[1]keitsgrad darzutun, mit welchen die einzigen diskutierten Gegenstande zum geschlos[1]senen Grab zuzusprechen sind. Wenn wir diesen Grad der Wahrscheinlichkeit abschliessend noch prozentuell ausdri.icken, dann mochte ich sagen, class die Zugehorigkeit der Situla, der eisernen Trense, zweier Lanzen, des Ti.illenbeiles und der Giirtelbeschlage hundertprozentig wahrscheinlich ist, die der beiden Figural[1]fibeln achtzigprozentig, und der beiden Bronzehalsringe fiinfzigprozentig. Dieselbe halbe Wahrscheinlichkeit ist auch der Zweizahl der Giirtelblecbe und der Tiillen[1]beile in einern Grab zuzusprechen; auch dafiir haben wir gute Analogien.~4 Selbstverstandlich mochten wir darnit nicht vollkomrnen die Moglichkeit ausschlies[1]sen, dass wir im Material aus dem J abr 1896 Grabbeigaben z wei er Mannerskelette vor uns haben. Das iibrige Material (Taf. 9- 10) kommt aus den Nekropolen aus der Umgegend vun Zagorje: Strahovlje, Suhi potok, šemnik (s. Karte 1). Das gesamte Material aus Zagorje und der Umgebung hat zwei wichtige Kennzeichen gemeinsam: die Bestattungsart (Skelettbestattung in flachen Nekro[1]polen, keine Grabhiigel) und die zeitliche Bestimmung: alle Graber sind junghall[1]stattisch und gehoren vorwiegend der jiingeren Phase dieser Zeitstufe an (Ha D 2-3). Diese Feststellung ist fiir die Besiedlungsgeschichte des Medijatales mass[1]gebend. Wertvoll ist die rekonstruierte Grabeinheit des fi.guralornamentierten Giir[1]telbleches (Taf. 7, 3). 34 Durch die eiserne Trense des skythischen Typus35 (Taf. 6, 1- 3) wurde jetzt das Giirtelblech gut in die zweite Stufe der jiingeren Hallstatt[1]periode (Ha D 2) datiert.36 Diese Bestimmung darf durch andere Begleitfunde erhartet werden, so z. B. durch die Halsringe (Taf. 6, 5. 6).37 Die beiden Tierfibeln (Taf. 7, 1. 2) gehoren in die verhaltnismassig zahlreiche Gruppe derartiger siid[1]ostalpiner Fibeln, die noch einer synthetischen Bearbeitung harren. 39 An dieser Stelle konnen wir bloss deren Stelle in der Entwicklung der siido_§talpinen Ilall[1]stattkultur skizzieren. In der aus Zagorje bekannten Gestalt ist die Fibel ein ausgesprochener Bestandteil der siidostalpinen Hallstattkultur,40 die Anregungen fiir eine theromorphe Gestaltung des Bogens sind aus Italien gekommen, wo wir einen Fibelbogen in Pferdeform schon im 8. Jh. kennen. Viel naher stehen unserer Fibel die Tierfibeln aus Este- Ricovero, Grab 149~ 2 (zweite Halfte des 7. Jh.) und aus Este- Benvenuti Grab 1:26 (Grab mit Benvenuti Situla), die schon mit grosserer W ahrscheinlichkeit die Dbernahmszeit dies er Fibelart anzeigen. Die Anregung zur si.idostalpinen Tierfibel ist aus Italien gekommen, u. zw. gegen Ende des ?. J ahrhunderts zugleich mit anderen italischen Motiven, die auch in der Situ[1]lenkunst wirksam waren. Die italische Anregung konnte jedoch nicht ganz die alten heimischen Elemente verdrangen, die noch aus der Urnenfelderkultur herstammten. So stelli die Fibel ein Beispiel des Synkretismus in der si.idostalpinen Hallstattkultur dar. Die italische Variante der Tierfibel wurde zur einheimischen umgestaltet; an die Stelle des Pferdes und einiger orientalischer Tiere43 ist im Si.idostalpenraum der einheimische Hund44 getreten. Als Abschluss des Fusses i.ibernahm der si.idostalpine Toreut das hemische Entlein aus der Urnenfelderzeitsymbolik; der griechisch[1]italische fliegende Vogel ist nicht durchgedrungen.45 So hat auch die Tierfibel, stilmassig betrachtet, auf unnati.irliche Art die lebhafte Erzahlungskunst des Mittel[1]merraumes der ruhigen symbolischen Aussage der Urnenfelderkultur beigesellt. Eine andere Besonderheit der si.idostalpinen Tierfibel besteht darin, dall sie - im Gegensatz zu den italischen und venetischen Stiicken - immer die Armbrust[1]konstruktion aufweist. Die ostalpine Tierkopffibel (Taf. 10, 10} wurde bereits von G. Merhart51 und Miiller-Karpe52 ausfi.ihrlich behandelt. Unsere Verbreitungskarte (Karte 2) zeigt deutlich ihre Heimat im siidostalpinen Hallstattkreis und ihre Ausbreitung ins innere Alpengebiet und nach Pannonien. Zeitlich ist Merharts und Miiller-Karpes Analyse bestatigt; die Fibel ist ein guter Beleg der spatesten Ha D Stufe (Ha D 3} im Sinn von Lt A und B in der mitteleuropaischen Chronologie. Ahnlich steht es mit der Fibel, deren Fuss in einem Pferde oder Widderkopf endet. Im Gegensatz zur vorhergehenden Fibel ist das Schema unserer Fibel durchaus certosisch, mit ihr zusammen hat sie immer die Arrnbrustkonstruktion. Typologisch ist sie als Derivat der Certosafibel anzusehen. Die Fibel ist eine si.ido[1]stalpine Bildung, wie aus unserer Verbreitungskarte (Karte 3} 56 klar hervorgeht. Sie ist jedoch im inneren Alpenraurn nicht so beliebt geworden wie die erste. Ihre chronologische Stellung ist nicht weit vom vorhergehenden Typus, nur lasst sich das wegen des Mangels von geschlossenen Funden nicht so genau nachweisen wie im vorhergehenden Fall. Im Sinne der mitteleuropaischen Chronologie ist sie in der ersten Fri.ihlatenestufe (Lt A nach Reinecke) nach.gewiesen, doch ist wahr[1]scheinlich auch bei diesern Typus mit einer Dauer bis zur Mittellatenestufe zu rechnen. Schliesslich sind da noch die Ohrringe aus Grab 3 in Strahovlje zu behandeln (Taf. 10, 14-19} . Was ins Auge fallt, ist ihre Ahnlichkeit mit altslowenischen Ohrringen. 58 Eine Analyse der Fundberichte zeigt irnrnerhin, dass es sich mit gros[1]serer Wahrscheinlichkeit urn ein Hallstattgrab handelt, zumal auch der Ohrring Eigenheiten zeigt, die im Hallstatter Milieu gut begreiflich sind (trapezfortnige Blechanhanger, mit getriebenen Punkten verziert). Die Ohrringe stehen zur Zeit in der Hallstattzeit noch sehr vereinzelt da; vergleichbar ware bloss der Ohrring aus dem Grabhi.igel in Bled. 61 Wir mi.issen sie wohl als junghallstattisch (Ha D 2-3} ansehen.
Prenosi
Prenosi
Objavljeno
Kako citirati
Številka
Rubrike
Licenca

To delo je licencirano pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodno licenco.
Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.
Podrobneje v rubriki: Prispevki