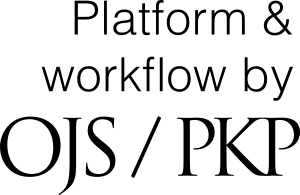Kulturna opredelitev materialne kulture na koliščih pri Igu
Povzetek
Sowohl das keramische als auch das übrige Material aus den Pfahlbauten bei lg sind bis jetzt schon öfters behandelt worden. Die Autorin ist auf Grund einiger sehr charakteristischen Elemente der Ansicht, dass dieses Material doch kein homo[1]genes Ganzes darstellt. Weil wir für diese Fundorte ausser einiger Anmerkungen Dežmans keine stratigraphischen Angaben haben, sucht die Autorin auf Grund einer typologischen Gliederung und einer Analyse der Keramik und der anderen Gegen[1]stände zu beweisen, dass wir es mit mehreren Gruppen zu tu haben. Ferner sucht sie den kulturellen Charakter der einzelnen Gruppen zu ergründen und sowohl die gegenseitigen Beziehungen der Pfahlbauten als auch ihre Beziehungen zu den an[1]deren Gruppen zu bestimmen. Auf Grund der keramischen und der anderen Formen, besonders aber auf Grund der ganzen Konzeption der Ornamentik und ihrer technischen Ausführung kommt die Autorin zum Schluss, dass man das kulturelle Material aus den Pfahl[1]bauten bei lg heutzutage in zwei Gruppen teilen müsse. Zur ersten Gruppe ge[1]hören Gefässe von amphoren- und krugartigen Formen, ferner Kreuzfußschalen mit hohlem Fuss, plastische Yasen und Idole. Ausserdem müssen her Miniatur[1]gefässe und grobausgeführte Gefässe gezählt werden. Alle diese Gefässe sind mehr kugelförmig oder oval, während bikonische selten sind. Der Hals ist in der Regel zylindrisch und scharf oder etwas sanfter von der Schulter getrennt. Der Boden ist immer klar angedeutet. Die Henkel sind kleiner, von rundem Profil, selten sind aber die Bandhenkel. Sie befinden sich an der Schulter oder verbinden die Schul[1]tern mit dem Mundrand. Häufig reichen sie nur bis zum Mundrand. Eine interes[1]sante Erscheinungsform sind Gefässe mit einer Öse, die einem Henkel entgegensetzt angebracht ist. Statt der Öse kann auch eine kleinere Tupfenleiste oder eine plasti[1]sche Warze Vorkommen. Bei einigen Gefässen ist der Knick in Form eines sphäri[1]schen Vierecks ausgeführt. Zur zweiten Gruppe gehören verschiedene Schüsseln, seltener einige Formen von Amphoren und Krügen, seichte Schalen, Becher, Fußschalen auf vollgearbei[1]tetem Fuss oder auf hohlem konischen Fuss und halbkugelförmige Schalen mit verdicktem Mundrand. Der untere Teil der Gefässe ist kugel- oder zwiebelförmig. Der Boden ist nicht besonders gekennzeichnet, es können aber daran auch ein Omphalos oder mehrere walzenförmige Füsschen sein. Bei einigen Beispielen von Schalen verengt sich der untere Teil in einen ausgesprochenen Boden, der auch ornamentiert sein kann. Der Hals ist scharf oder sanfter von der Schulter getrennt. Bei einigen Beispielen ist der Hals auch trichterförmig erweitert. Seltener ist ein zylindrischer Hals. Bei einigen Formen ist der Hals nicht von der Schulter ge[1]trennt, so dass das Gefäss glockenförmig wird. Der Knick ist oft scharf oder es befinden sich hohle oder plastische Buckeln an der Peripherie. Die Henkel sind von rundem Profil, Bandhenkel sind selten und verbinden die Schultern mit dem Mund[1]rand oder die Schultern mit dem Hals unterhalb des Mundrandes. Einige Henkel haben auch einen sogenannten Schnurrbart an beiden Enden. Sehr oft findet man auch subkutane Ösen an der grössten Peripherie. Am meisten charakteristisch ist die Ornamentik. Dadurch wird auch unsere Keramik in zwei Gruppen geteilt. Bei der ersten sind die Ornamente eingeritzt oder im Furchenstich ausgeführt. Ausserdem findet man da auch grössere oder klei[1]nere schief angebrachte Stiche. Das Motiv stellt ein Band dar, das auf der unteren und oberen Seite und am Henkel geschlossen ist. Ein solches Band ist in Metopen geteilt, die mit verschiedenen geometrischen Formen, Kreisen, konzentrischen Krei[1]sen mit oder ohne Kreuz, mit Kreuzen, schraffierten Dreiecken usw. ausgefüllt sind. Die Ornamentik befindet sich meistens an der grössten Perinherie. doch ist auch unter dem Mundrand eine eingeritzte Zickzacklinie. Auch die Henkel können ornamentiert sein. Interessant ist die Ornamentik der Kreuzfußschalen. Sowohl die Innen — wie auch die Aussenseite sind ornamentiert, und ausserdem auch der Fuss und sogar die Stellfläche. Beim Suchen nach der Verwandtschaft zwischen der Badener-Péceler Kultur und unserer ersten Gruppe kommt die Autorin zum Schluss, dass ausser einer ent[1]fernten Verwandtschaft nur unbedeutende gemeinschaftliche Elemente vorhanden sind. Die Kreuzfußschale in diesen zwei Kulturgruppen zeugt nur davon, dass beide zur selben Zeit existiert haben. Die zweite Gruppe hat Analogien im Südosten in der Glockenbecherkultur, und in ihren jüngeren Phasen in Nordwesten und in den Kulturen, die unter dem Einfluss der Glockenbecherkultur entstanden sind. Mit Hinsicht darauf könnte man den Ursprung für unsere zweite Gruppe in der Remedello Kultur suchen. Die Analogien in den übrigen erwähnten Kulturen spre[1]chen für Gleichzeitigkeit unserer zweiten Gruppe. Die grosse Zahl der charakte[1]ristischen keramischen Elemente der Glockenbecherkultur im Kreis unserer zweitenGruppe kennzeichnet sie als eine Art Fazies davon, mit einigen jüngeren Elementen als sie in der Remedello Kultur zu finden sind. Eine ähnliche Einteilung kann man auch auf Grund der übrigen in Tg gefundenen Gegenstände vornehmen. Dafür, dass sich die ältere Gruppe, Tg T genannt, zeitlich mit der Gruppe lg II berührte, sprechen einige keramische Formen, die Elemente sowohl der ersten wie auch der zweiten Gruppe aufweisen. Auf Grund einiger Elemente aus dem Kultur[1]kreis der Ostalpen-Lengyel Fazies kann man den Beginn der ersten Gruppe als gleichzeitig mit dem Ende dieses Kulturkreises ansetzen. Auf Grund der schon völlig bronzezeitlichen Elemente der zweiten Gruppe kann man aber das Ende dieser Gruppe schon unter das Ende der älteren Bronzezeit setzen
Prenosi
Prenosi
Objavljeno
Kako citirati
Številka
Rubrike
Licenca

To delo je licencirano pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodno licenco.
Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.
Podrobneje v rubriki: Prispevki